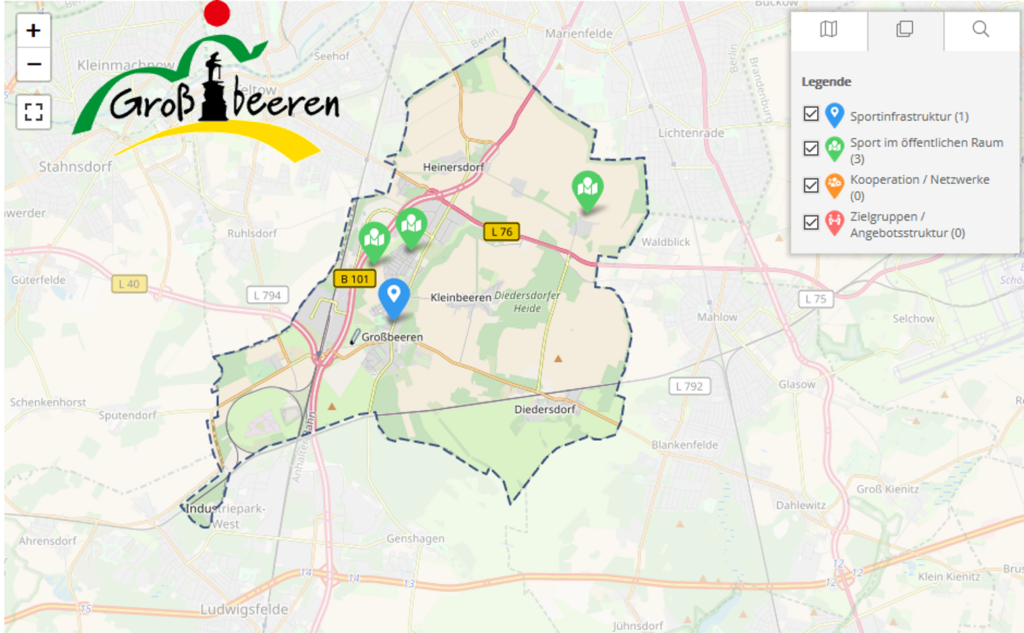Wünsche der Wedelerinnen und Wedeler flossen in die Analyse ein.
Im Juni 2019 war die Stadt Wedel mit einer Bürgerinnen- und Bürgerbefragung in eine gezielte Sportentwicklungsplanung eingestiegen. Unter Federführung von Prof. Dr. Michael Barsuhn, dem wissenschaftlichen Leiter des Instituts für kommunale Sportentwicklungsplanung (INSPO) an der Fachhochschule für Sport und Management Potsdam, waren die Ergebnissen zusammen mit einer Steuerungsgruppe aus Politik, Sport und Verwaltung analysiert worden.
Die Ergebnisse liegen nun in einem 171 Seiten starken Abschlussbericht vor. Der Bericht war am 2. Juni den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport (BKS) vorgelegt worden. Am 25. August soll über die Ergebnisse im BKS beraten werden.
Interessierte können den Bericht unter diesem Link einsehen.
Hintergrund Sportentwicklungsplan
Bewegen Sie sich gern? Wo treiben sie Sport und welche Sport- oder Bewegungsformen bevorzugen Sie? Wo sehen Sie in der Stadt Wedel noch Verbesserungsmöglichkeiten? Welche Wünsche und Vorstellungen in Sachen Sport und Bewegung haben Sie?
Diese und viele weitere Fragen waren Bestandteil einer großen Umfrage, die im Juni 2019 in der Stadt Wedel startet. Insgesamt 4.000 per Zufall ausgewählte Bürgerinnen und Bürger wurden anonym zu ihrem Sport- und Bewegungsverhalten befragt.
Die Befragung liefert einen wichtigen Teil der Grundlagen für eine Sportentwicklungsplanung in der Rolandstadt. Im Ergebnis lagen der Stadtverwaltung mehr als 1000 ausgefüllte Fragebögen vor, die durch das beauftragte Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung (INSPO) an der Fachhochschule für Sport und Management Potsdam ausgewertet wurden.
Auf Grundlage der Fragebögen hatte das INSPO ermittelt, wie aktiv die Wedelerinnen und Wedeler sind, was die präferierten Sportarten sind, welche Sport- und Bewegungsräume vorrangig genutzt werden und welche Investitionsbedarfe aus Bürgersicht, aber auch aus Vereinssicht im Fokus stehen. Daher wurden zusätzlich Sportvereine, Schulen und Kindertagesstätten in eigenen Umfragen beteiligt.
Die wissenschaftlichen Analysen wurden durch das von der Stadtverwaltung beauftragte Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung (INSPO) an der Fachhochschule für Sport und Management Potsdam durchgeführt und fachlich begleitet.
(Sven Kamin/Stadt Wedel, 21.6.2021)
“ Quelle: Sven Kamin/Stadt Wedel, abgerufen am 21.06.2021 (https://www.wedel.de/rathaus-politik/newsdetail/sportentwicklungsplanung-abschlussbericht-steht-bereit?fbclid=IwAR2pfzoC2m93maJAS8ZAsBOOr63iOZ-Q0BI99q1OxvUsE5CfG0iLk-yECto).
Dieser Text ist am 21.06.2021 auf der Homepage der Stadt Wedel erschienen (hier online verfügbar).